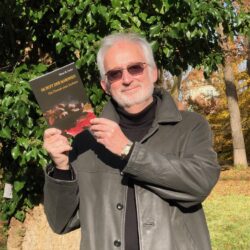Psychische Gesundheit ist keine Privatsache
Menschlich bleiben – die beste Prävention? Ein Interview über Angst und Mut
Elke hat einen der prägenden Brückenbauer der deutschen Psychiatrie kennengelernt und interviewt – bei bzw. nach ihrer Moderation einer Jahrestagung in Köln. Als Hauptredner war Prof. Thomas Bock eingeladen, zur Psychiatrie-Enquete, die vor 50 Jahren ihre Arbeit darlegte, Stellung zu beziehen.

Bock, Professor für klinische Psychologie und Sozialpsychiatrie, ist Experte für bipolare Störungen und Psychosen und wird auch in den etablierten Medien gern befragt, wenn z.B. ein Vorfall passiert und es dann (vorschnell) heißt: „Psychisch krank.“
Was heißt das eigentlich, dieses „psychisch krank“?
Bevor Elke ihn interviewt hat (das Interview lest ihr unten) war ihr Bock auch deshalb aufgefallen, weil er Diskussionsformate zu aktuellen Themen durchführt – in der Online-Vorlesungsreihe: „Anthropologische Psychiatrie“ mit der übergeordneten Frage „Bock auf Dialog?“ Im vergangenen Sommersemester ging es beispielsweise sehr um junge Menschen, Titel: „Angst von Kindern und Jugendlichen um diese Welt – Aufgabe der Psychiatrie?“
Interview mit Prof. Thomas Bock
Sie sagen, die Verantwortung für psychische Gesundheit müsse breiter verteilt werden, warum?
Thomas Bock: Die Psychiatrie muss sich wieder auf das konzentrieren kann, wofür sie am meisten gebraucht wird und zu anderen Themen gesellschaftliche Diskurse anstoßen. Zum Beispiel sind alle mehr oder weniger psychisch belastet. Kriegsgefahr, Umweltzerstörung, Intoleranz in der Gesellschaft. Auch die aktuelle COPSY-Studie sagt: Junge Menschen fühlen sich immer noch, auch wenn Corona vorbei ist, mehr als vorher belastet. Das ist erschreckend, aber auch beruhigend: Sie internalisieren nicht, sondern benennen, was sie bedrückt. Entscheidend ist: Wir dürfen das nicht pathologisieren, sondernd sollten sie unterstützen, damit nicht allein zu bleiben.
Von welcher Not reden Sie konkret?
Jungen Menschen lastet vieles auf der Seele: Sie nehmen die Bedrohung von außen stark wahr. Sie haben durch die zunehmende Umweltzerstörung, die wachsende Ungerechtigkeit und den näher rückenden Krieg Angst um diese Welt. Diese Not ist ernst zu nehmen, doch die Lösung liegt nicht in der Psychiatrie. Junge Menschen brauchen keine neue Diagnose, sondern eine Ermutigung sich zu wehren, ein Teilen der Angst und vor allem eine verantwortliche demokratische Politik.
Sie sprechen das Thema Wohnungsnot an, die Spannbreite von arm und reich …
Genau. Nehmen Sie noch die Ungleichverteilung von Arbeit und andere prekäre Lebensbedingungen wie Einsamkeit, Ausgrenzung und Diskriminierung dazu. All diese Faktoren entscheiden mit über Häufigkeit und Verlauf psychischer Erkrankungen.
Viele Menschen suchen psychologische Betreuung, es ist schwer einen Ansprechpartner zu finden.
So ist das. Immer mehr Menschen suchen ihr Heil in der Psychiatrie. Die Angst vor Psychiatrie hat abgenommen, die vor manchen Diagnosen auch, vor anderen jedoch nicht. Bei manchen diskutieren wir über Diversität, bei anderen über Forensik – eine krasse und ungerechte Ungleichheit. Ein ZEIT- Dossier trug den Titel „Sind wir alle Trauma?“
Erklären Sie uns das?
Früher mussten wir Menschen von ihrer Krankheit überzeugen, heute vom Gegenteil. Der Begriff von psychischer Erkrankung wurde in den letzten Jahren immer weiter und banaler, oft wird menschliches Leid zur Krankheit umgedeutet. Das geschieht möglicherweise auch, weil soziale und familiäre Hilfen weniger zur Verfügung stehen. Doch was folgt daraus angesichts des gleichzeitigen Fachkräftemangels?
Vielleicht, dass denen, die schwere Suchterkrankungen, Psychosen oder Manien haben, weniger geholfen werden kann?
Ja, diese Menschen zahlen die Zeche doppelt: Sie werden weiter und mehr stigmatisiert und für viele von Ihnen fehlen die Ressourcen für eine angemessen komplexe Hilfe. Auch die Menschen, die längerfristig psychisch erkrankt sind, müssen als Subjekte wahr- und ernstgenommen werden. Ich fürchte aber, dass ökonomische Zwänge in die falsche Richtung führen. Jetzt muss die Politik Prioritäten setzen – und die Psychiatrie muss sie in Verantwortung nehmen.
Prävention und Inklusion als Aufgabe der Politik können nach Ihren Worten „nicht nur im psychiatrischen System geklärt werden“. Bezogen auf die Grundrechte – wo muss sofort damit begonnen werden?
Wohnen, Arbeit, Teilhabe sind Voraussetzung für jede Eingliederungshilfe. Bei Geflüchteten spielt zudem die kulturelle Resonanz eine große Rolle. Hier zeigt eine spannende Studie, dass nicht das Trauma der Herkunft oder Flucht, sondern das der Ankunft entscheidend ist.
Sie haben dieses Jahr einen Offenen Brief an Bundeskanzler Merz geschrieben (hier nachzulesen). Was hat dieser erreicht und würden Sie es wieder tun?
Auch heute noch dienen Geflüchtete – auch ohne Straftaten – als Schuldige bzw. Ausrede für alle ungelösten sozialen Probleme. Bundeskanzler Scholz hat ebenfalls einen offenen Brief bekommen, als er im Wahlkampf den damaligen Berliner Kultursenator als „Hofnarr der CDU“ bezeichnet hat. Aber mehr, um die Hofnarren in Schutz zu nehmen, die meist weise Menschen waren, die als einzige dem Herrscher die Wahrheit sagen durften … Im Moment stecke ich jedoch mehr und viel Kraft in meine Podcasts und Videos, die ich für den Verein Irre menschlich an der Uni Hamburg mache. Dort kommen Expert*innen zu allen Diagnosen zu Wort, zur COPSY-Studie und aktuell zu besonderen Problemen junger Menschen.
Sie sagen, es sei gelungen die Psychiatrie zu ent-stigmatisieren, aber nicht (alle) psychisch erkrankten Menschen … was muss weiter getan werden?
Burnout ist sehr entstigmatisiert, Depression auch. Bei ADHS und Autismus reden wir von „Divergenz“ – was unterschiedlich besetzt werden kann: Als neues Selbstbewusstsein oder als verkappter Biologismus. Bei Menschen mit Psychose- oder Manie-Erfahrung ist die Entwicklung noch brüchig und widersprüchlich. Bei Menschen mit schwerer Suchterkrankung auch und vielleicht erst recht.
Was erfreut Sie?
Der Trialog hat einiges dafür getan, psychische Erkrankungen nicht nur pathologisch, sondern auch anthropologisch zu betrachten. Zum Beispiel nicht nur zu fragen: Was ist normabweichend, sondern auch „Was ist zutiefst menschlich, uns allen möglich – wenn auch in verschiedener Ausprägung?“
Um Ängste zu reduzieren?
Ja, die Erkenntnis eines fließenden Übergangs reduziert Angst und entstigmatisiert. Das ist wichtig, aber unterschiedlich gut gelungen. Wir brauchen politische Unterstützung. Prävention ist eine gesellschaftliche Aufgabe und eine kommunalpolitische Herausforderung. Sie braucht viele gewichtige Weichenstellungen – z.B. in Richtung Frieden, soziale Gerechtigkeit und bunte Stadtbilder. Ich wünsche mir einen breiten gesellschaftlichen Diskurs, der die komplexen Dinge zusammenbringt und ein Auseinanderdriften verhindert. Letztlich kann wohl nur die Demokratie die Basis sein, um psychische Gesundheit zu wahren und Hilfen bei Erkrankung sozial gerecht zu verteilen.
Thomas Bock war auf Einladung der PSAG Köln in der Domstadt am Rhein. Die Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft umfasst Fachkräfte, ehrenamtliche Helfer*innen, Angehörige und Betroffenen aus den Arbeitsfeldern der Gesundheits-, Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe, in denen psychosoziale Belange eine besondere Bedeutung haben. Ihre Aufgabe ist es, die fachliche Zusammenarbeit zwischen den im Psychiatrie- und Suchtbereich tätigen Verbänden, Vereinen und Diensten zu verbessern, Mängel in der psychiatrischen und psychosozialen Versorgung Kölns aufzudecken und Lösungsansätze zu erarbeiten.
 Thomas Bock würde ich als Koryphäe im Bereich der Psychiatrie bezeichnen. Stetig und konsequent wirbt er dafür, dass Betroffene, Angehörige und Professionelle auf Augenhöhe miteinander sprechen – Stichwort der von ihm mitbegründete Trialog, als dessen Vater ihn viele bezeichnen.
Thomas Bock würde ich als Koryphäe im Bereich der Psychiatrie bezeichnen. Stetig und konsequent wirbt er dafür, dass Betroffene, Angehörige und Professionelle auf Augenhöhe miteinander sprechen – Stichwort der von ihm mitbegründete Trialog, als dessen Vater ihn viele bezeichnen.
Ich habe die Tagung auf Empfehlung von Andrea Lohmann, die beim Deutschen Roten Kreuz im Kreisverband Köln die Abteilung Psychiatrie leitet, moderiert.
Auf dem Foto steht Andrea links, rechts neben mir die Sozial- und Sucht-Expertin Ulla Schmalz.